Margarete Böhme (1867–1939), geboren als Wilhelmine Margarete Susanna Feddersen in Husum, war eine der meistgelesenen deutschen Autorinnen des frühen 20. Jahrhunderts. Bereits im Alter von 17 Jahren veröffentlichte sie erste Texte in Zeitschriften und wandte sich früh dem literarischen Schreiben zu. Nach der Heirat mit dem Journalisten Friedrich Theodor Böhme zog sie nach Berlin, wo sie sich nach der Trennung vom Ehemann vollständig der Schriftstellerei widmete. Dort arbeitete sie auch als Journalistin und Literaturkritikerin. Ihr internationaler Durchbruch gelang 1905 mit dem Werk „Tagebuch einer Verlorenen“, das unter dem Vorwand erschien, ein authentisches Tagebuch einer jungen Prostituierten namens Theres(e) zu sein. Das Buch wurde ein Sensationserfolg: Es verkaufte sich über 1,2 Millionen Mal, wurde in 14 Sprachen übersetzt und mehrfach (1907, 1918 und 1929) verfilmt. Besonders bekannt wurde die Verfilmung von 1929 mit Louise Brooks in der Hauptrolle, die dem Werk bis heute eine gewisse popkulturelle Präsenz verleiht. Böhme veröffentlichte insgesamt etwa 40 Romane, Erzählungen und Novellen, darunter auch sozialkritische und psychologisch orientierte Werke. Besonders gelobt wurde ihr Roman „W.A.G.M.U.S.“ von 1911, der sich mit der Mechanisierung des modernen Lebens und der Anonymität in der Großstadt beschäftigt – Themen, die für ihre Zeit bemerkenswert modern wirkten. Weitere bekannte Titel sind „Christine Immersen“ und „Sarah von Lindholm“. Viele ihrer Werke thematisieren das Leben von Frauen, insbesondere die Einschränkungen und Herausforderungen durch gesellschaftliche Normen und patriarchale Strukturen. Obwohl sie zu Lebzeiten große Erfolge feierte, geriet Böhme nach ihrem Tod und insbesondere nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Vergessenheit. Ihre Bücher wurden nicht mehr aufgelegt, und ein Großteil ihres Werks fiel der Zensur oder dem Desinteresse zum Opfer. Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts kam es zu einer Wiederentdeckung, insbesondere durch das gestiegene Interesse an Louise Brooks und dem feministischen Diskurs, der das „Tagebuch einer Verlorenen“ neu bewertete. Böhme starb 1939 in Hamburg, verarmt und vergessen – ein Schicksal, das sie mit vielen anderen erfolgreichen Schriftstellerinnen ihrer Zeit teilt. Heute gilt sie als wichtige Vertreterin einer frühen feministischen Literaturströmung und als Pionierin des dokumentarisch-literarischen Schreibens. Quellen: Wikipedia (deutsch): Ernst Harthern (1884–1969), geboren als Ernst Ludwig Jacobson in Stade, war ein deutscher Journalist, Schriftsteller und Übersetzer. Unter dem Pseudonym Niels Hoyer veröffentlichte er zahlreiche Werke und setzte sich intensiv mit seiner jüdisch-deutschen Identität auseinander. Nach dem frühen Tod seiner Mutter wuchs Harthern bei seiner Tante Frieda Freudenstein auf. Seine Jugend war geprägt von finanziellen Schwierigkeiten und persönlichen Krisen, einschließlich mehrerer Haftstrafen und Suizidversuche. Trotz dieser Herausforderungen begann er eine journalistische Karriere und arbeitete ab 1911 als Auslandskorrespondent für die Frankfurter Zeitung. Er übersetzte Werke skandinavischer Autoren wie Bjørnstjerne Bjørnson und Knut Hamsun ins Deutsche und trug so zum kulturellen Austausch zwischen Skandinavien und Deutschland bei. 1921 änderte er seinen Namen offiziell in Ernst Harthern. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde er aufgrund seiner jüdischen Abstammung verfolgt, 1933 entlassen und 1936 ausgebürgert. Er lebte im Exil in Dänemark und später in Schweden, wo er weiterhin als Journalist und Übersetzer tätig war. Harthern veröffentlichte rund 70 Übersetzungen skandinavischer Literatur ins Deutsche. Sein literarisches Werk umfasst unter anderem den Roman Axel Mertens Heimat (1913) und Heimwärts, in dem er seine Eindrücke einer Palästina-Reise verarbeitet. Besondere Bekanntheit erlangte er durch die Herausgabe von Lili Elbe. Ein Mensch wechselt das Geschlecht (1932), das die Geschichte der dänischen Malerin Lili Elbe erzählt, einer der ersten Personen, die sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzog. Dieses Werk wurde später unter dem Titel Man into Woman international bekannt und diente als Grundlage für den Roman The Danish Girl von David Ebershoff sowie dessen Verfilmung (2015). Harthern starb 1969 in Sigtuna, Schweden. Sein umfangreicher Nachlass wird in der Stifts- und Landesbibliothek Västerås aufbewahrt. In Deutschland ist er weitgehend in Vergessenheit geraten, obwohl er als bedeutender Kulturvermittler zwischen Skandinavien und Deutschland gilt. Quellen: Lohmann, Hartmut: Der Landkreis Stade in der Zeit des Nationalsozialismus, Stade 1991, ISBN 3-9802018-1-3. Bohmbach, Jürgen: Sie lebten mit uns – Juden im Landkreis Stade vom 18. bis 20. Jahrhundert, Stade 2001. Nielsen, Birgit S.: "Ernst Harthern (1884–1969). Schriftsteller, Journalist, Übersetzer", in: Dähnhardt, Willy; Nielsen, Birgit S. (Hrsg.): Exil in Dänemark: deutschsprachige Wissenschaftler, Künstler und Schriftsteller im dänischen Exil nach 1933, Heide: Westholsteinische Verlagsanstalt Boyens, 1993, S. 513–519. Guðmundsdóttir, Guðrún Hrefna: Halldór Laxness und Deutschland, in: Skandinavistik, 2001.Ruprecht, Uwe: "Die Kugel im Rücken – Ernst Hartherns Heimsuchung", Vortrag vom 8. Mai 1995, online verfügbar: https://ruprecht.art.blog/2018/06/15/die-kugel-im-ruecken/ Anna Siemsen (1882–1951) war eine deutsche Pädagogin, Politikerin, Publizistin und engagierte Pazifistin, die sich ihr Leben lang für Bildung, soziale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und internationale Verständigung einsetzte. Sie gilt als eine der bedeutendsten Vertreterinnen reformpädagogischer und sozialistischer Bildungsideen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Geboren wurde Anna Siemsen am 18. Januar 1882 in Mark bei Hamm (Westfalen) als Tochter eines protestantischen Pfarrers. Ihre Familie war intellektuell geprägt – mehrere ihrer Brüder, darunter der linke Publizist Hans Siemsen, waren ebenfalls politisch aktiv. Nach dem Besuch einer höheren Mädchenschule machte Anna 1901 ihr Lehrerinnenexamen, nahm dann ein Studium der Germanistik, Philosophie und Pädagogik auf und promovierte 1909. Anschließend arbeitete sie als Lehrerin und Schulrätin, unter anderem in Bremen, Düsseldorf und Berlin. Früh engagierte sie sich in der Schulreformbewegung. Sie wurde Mitglied im Bund Entschiedener Schulreformer (BESch) und setzte sich für eine demokratische, sozial gerechte und kindgerechte Bildung ein. 1923 erhielt sie eine Honorarprofessur für Pädagogik an der Universität Jena – als eine der ersten Frauen in Deutschland, die in diesem Fach akademisch lehrten. Politisch engagierte sie sich zunächst in der USPD, später in der SPD, und wurde 1928 als SPD-Abgeordnete in den Reichstag gewählt. Siemsen zählte zu den linken Pazifistinnen innerhalb der Partei und plädierte für Abrüstung, Frauenrechte und Bildungsgerechtigkeit. 1931 wechselte sie zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD), einer linken Abspaltung der SPD, die sich entschieden gegen den Faschismus stellte. Nach der Machtergreifung Hitlers 1933 emigrierte Siemsen zunächst in die Schweiz, dann nach Dänemark. Dort setzte sie sich publizistisch gegen das NS-Regime ein und war im antifaschistischen Widerstand aktiv. Nach dem Krieg kehrte sie nach Deutschland zurück und lebte zuletzt in Hamburg, wo sie 1951 starb. Anna Siemsen hinterließ zahlreiche Schriften zu Bildungsfragen, Pazifismus und Demokratie. Ihr Wirken hat Spuren in der deutschen Bildungslandschaft hinterlassen. Einige Schulen und Bildungseinrichtungen tragen heute ihren Namen. Ihr Leben steht beispielhaft für die Verbindung von Pädagogik und politischer Verantwortung. Quellen: August Siemsen: Anna Siemsen – Leben und Werk. Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 1951. Inge Hansen-Schaberg: Pädagoginnen im Exil: Frauen der Reformpädagogik in der Emigration 1933–1945, Schneider Verlag Hohengehren, 2004. Dähnhardt, Willy (Hrsg.): Exilpädagogik: Deutsche Pädagogen im Ausland 1933–1945, Juventa Verlag, 1993. Gudrun Loster-Schneider: Anna Siemsen: Pädagogin zwischen Reform und Revolution, Beltz Verlag, 1982. Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933, Band 2: Politik, Wirtschaft, Öffentliches Leben, K. G. Saur, München 1983. Karl Tschuppik (1876–1937) war ein österreichischer Journalist, Feuilletonist und Publizist, der als eine der bedeutendsten Figuren des österreichischen Journalismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gilt. Geboren in Mělník, Böhmen, studierte Tschuppik zunächst technische Wissenschaften in Zürich und Wien. Nach dem Studium zog er zurück nach Prag, wo er seine journalistische Karriere beim Prager Tagblatt begann. Ab 1898 war er dort zunächst als Redakteur und später als Chefredakteur tätig. Tschuppik war während des Ersten Weltkriegs ein Verfechter des Deutschnationalismus, wandte sich jedoch später dem Pazifismus zu. Nach der Niederlage Österreich-Ungarns und der Gründung der Ersten Republik Österreich setzte er sich für den Erhalt eines unabhängigen, demokratischen Österreichs ein. Ab 1917 arbeitete er in Wien und war in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften tätig, unter anderem in der pazifistischen Wochenschrift Der Friede und dem Neuen Wiener Tagblatt. 1923 wurde er Chefredakteur der Boulevardzeitung Die Stunde, die trotz ihres populären Stils eine klare politische Linie verfolgte. Tschuppik setzte sich für eine demokratische, antifaschistische Haltung ein, wobei er sich sowohl gegen Links- als auch Rechtsextremismus stellte. Seine Zeit bei Die Stunde war jedoch von Konflikten mit anderen Journalisten und Schriftstellern geprägt, insbesondere mit Karl Kraus, der Tschuppik vorwarf, die journalistische Qualität zu gefährden. 1926 verließ er die Zeitung und zog nach Berlin, wo er für verschiedene kulturelle Zeitschriften wie Das Tage-Buch und Der Querschnitt schrieb. In den späten 1920er- und frühen 1930er-Jahren widmete Tschuppik sich zunehmend biografischen Arbeiten. Er verfasste Monografien über bekannte historische Persönlichkeiten wie Franz Joseph I., Kaiserin Elisabeth, Maria Theresia und Erich Ludendorff, in denen er politische Persönlichkeiten als Menschen mit persönlichen Schwächen darstellte, deren Handeln von persönlichen Motiven geprägt war. Aufgrund seiner antifaschistischen Haltung geriet Tschuppik zunehmend in den Fokus nationalsozialistischer Propaganda, und 1933 wurde er auf die erste "Schwarze Liste" der Bücherverbrennungen gesetzt. Im Jahr 1933 kehrte Tschuppik nach Wien zurück und setzte seine journalistische Arbeit fort, indem er für die Zeitungen Der Morgen und die Wiener Sonn- und Montagszeitung schrieb. In seinen letzten Jahren kritisierte er sowohl den Austrofaschismus als auch den aufkommenden Nationalsozialismus und warnte vor der Gefahr einer "Überdeutschung" Österreichs. Tschuppik starb überraschend am 22. Juli 1937 in Wien. Tschuppiks Werk umfasst eine Vielzahl von journalistischen Beiträgen und biografischen Schriften. Besonders hervorzuheben sind seine Bücher Franz Joseph I. Der Untergang eines Reiches (1928), Elisabeth. Kaiserin von Österreich (1929) und Maria Theresia (1934). Auch sein einziges literarisches Werk, der Roman Ein Sohn aus gutem Hause (1937), wurde posthum verfilmt. Quellen: Amann, Klaus (Hrsg.): Karl Tschuppik: Von Franz Joseph zu Adolf Hitler. Polemiken, Essays und Feuilletons. Böhlau Verlag, Wien/Köln/Graz 1982. Prokopp, Klaus: Konformismus und Konfrontation. Der Journalist Karl Tschuppik (1876–1938) und seine Leitartikel im Prager Tagblatt 1914–1918. Diplomarbeit, Universität Klagenfurt, 1995. Röder, Werner; Strauss, Herbert A. (Hrsg.): International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933–1945. Band 2,2. München: Saur, 1983. Kesten, Hermann: Dichter im Café. München/Wien/Basel, 1959. Torberg, Friedrich: Die Tante Jolesch. Verlag LangenMüller, München 2008. Staudinger, Anton: Christlichsoziale Partei und Errichtung des 'Autoritären Ständestaates'. In: Jedlicka, Neck: Vom Justizpalast zum Heldenplatz. Österreichische Staatsdruckerei, Wien 1975. Ernst Barlach (1870–1938) war ein herausragender deutscher Bildhauer, Grafiker und Schriftsteller, der als einer der bedeutendsten Künstler des Expressionismus gilt. Sein Werk ist von einer tiefen Auseinandersetzung mit den Themen Leid, Tod und Spiritualität geprägt, was ihn zu einer Schlüsselfigur der modernen Kunst machte. Barlach wurde am 2. Januar 1870 in Wedel bei Hamburg geboren und wuchs als ältester von vier Söhnen eines Arztes auf. Nach dem Tod seines Vaters zog die Familie nach Ratzeburg. Er besuchte die Realschule und begann 1888 ein Studium an der Gewerbeschule in Hamburg, bevor er 1891 an die Kunstakademie Dresden wechselte. 1895 beendete er sein Studium und verbrachte anschließend mehrere Jahre in Paris, wo er sich vor allem schriftstellerisch betätigte und begann, sich einen eigenen künstlerischen Stil zu erarbeiten. Ab 1897 arbeitete Barlach als freischaffender Künstler. Er zog zunächst nach Wedel zurück und begann, sich auch mit dramatischen Texten und Keramiken zu beschäftigen. 1906 unternahm er eine prägende Reise nach Russland, die seine Kunst nachhaltig beeinflusste. 1907 stellte er in der Berliner Secession aus, und 1909 hielt er sich als Stipendiat in der Villa Romana in Florenz auf. In dieser Zeit entwickelte er seinen markanten, expressionistischen Stil weiter. 1911 ließ sich Barlach in Güstrow nieder, wo er ein Atelier am Inselsee errichtete und einen Großteil seiner Werke schuf. Die Erlebnisse des Ersten Weltkriegs beeinflussten seine Kunst, und er wandte sich verstärkt den Themen Krieg, Leid und Tod zu. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg schuf er eine Reihe von Kriegerdenkmälern, die als Mahnmale des Krieges und der Opfer galten. Ein herausragendes Beispiel ist das Ehrenmal Schmerzensmutter in Kiel, das 1922 eingeweiht wurde. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten geriet Barlach in Konflikt mit dem Regime. 1933 wurde er aus der Preußischen Akademie der Künste entlassen, und viele seiner Werke wurden von den Nationalsozialisten als "entartete Kunst" bezeichnet und aus den Museen entfernt. 1937 wurde er von der Ausstellungstätigkeit ausgeschlossen und seine Arbeiten zunehmend zensiert. Trotz dieser Repressionen blieb Barlach künstlerisch aktiv. Er setzte seine Arbeiten fort und widmete sich zunehmend spirituellen und metaphysischen Themen. Am 24. Oktober 1938 starb er überraschend in Rostock an einem Herzinfarkt. Heute gilt er als einer der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts, dessen Werk auch heute noch stark beeindruckt. Quellen: Ernst Barlach: Leben und Werk – Eine umfassende Biografie, die das Leben und die künstlerische Entwicklung von Barlach detailliert darstellt. Expressionismus und der Erste Weltkrieg – Analyse der Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf Barlachs künstlerische Arbeiten, insbesondere seine Kriegerdenkmäler. Barlach und die 'Entartete Kunst' – Untersuchung der Rezeption von Barlachs Werk durch die Nationalsozialisten und der Zerstörung seiner Denkmäler und Skulpturen. Die Kunst der Zwischenkriegszeit – Betrachtung von Barlachs Einfluss auf die Kunst der Weimarer Republik und seine Rolle als politischer Künstler. Alfred Kantorowicz (1899–1979) war ein deutscher Jurist, Publizist und Literaturwissenschaftler, dessen Leben und Werk von den politischen Umwälzungen des 20. Jahrhunderts und seiner Rolle als Intellektueller im Exil geprägt wurden. Er gehörte der jüdischen Intelligenzija an und engagierte sich sowohl gegen den aufkommenden Nationalsozialismus als auch für die sozialistische Bewegung. Als Schriftsteller, Aktivist und Literaturwissenschaftler hinterließ er ein bleibendes Erbe in der deutschen Exilliteratur. Kantorowicz wurde am 27. Oktober 1899 in Berlin geboren. Nach dem Abitur meldete er sich 1917 freiwillig zum Ersten Weltkrieg und wurde schwer verwundet. Nach dem Krieg studierte er Rechtswissenschaften in Berlin, Freiburg und Erlangen, wo er erste politische Kontakte knüpfte. Bereits in den 1920er Jahren zeigte er ein starkes Interesse an politischen Themen und trat der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) bei. Als Redakteur der Vossischen Zeitung engagierte er sich in der Weimarer Republik gegen die aufkommende Gefahr des Nationalsozialismus. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 floh Kantorowicz nach Frankreich, wo er seine politische Arbeit fortsetzte. Er war aktiv an der Herausgabe des „Braunbuchs“ beteiligt, das die Verbrechen des Nazi-Regimes dokumentierte. Er wurde Generalsekretär des „Schutzverbandes deutscher Schriftsteller im Ausland“ und gründete 1934 die „Deutsche Freiheitsbibliothek“ in Paris, die verbotene deutsche Literatur sammelte. Während des Spanischen Bürgerkriegs kämpfte er auf der Seite der Republikaner gegen das Franco-Regime. 1941 emigrierte Kantorowicz in die USA, wo er weiterhin gegen den Nationalsozialismus und für die Rechte von Exilanten eintrat. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte er 1946 nach Deutschland zurück. In Berlin gründete er die Zeitschrift Ost und West, die sich mit den kulturellen und politischen Fragen der Zeit beschäftigte. Er trat der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) bei und wurde Professor für neue deutsche Literatur an der Humboldt-Universität zu Berlin. In dieser Funktion widmete er sich vor allem der Erforschung der Exilliteratur und arbeitete als Herausgeber der Werke von Heinrich Mann. 1957 kam es zu einem Bruch mit der SED, als Kantorowicz sich gegen die Politik der DDR wandte. Dieser Konflikt führte zu seiner Flucht in die Bundesrepublik Deutschland. In der Bundesrepublik setzte er seine Arbeit als Literaturwissenschaftler fort und veröffentlichte 1971 seine Erinnerungen unter dem Titel Exil in Frankreich. Merkwürdigkeiten und Denkwürdigkeiten, in denen er seine Erfahrungen im Exil schilderte. Kantorowicz starb am 6. März 1979 in Hamburg. Trotz der Widrigkeiten, die sein Leben prägten, blieb er Zeit seines Lebens ein engagierter Schriftsteller und Wissenschaftler, der die politische und literarische Entwicklung seiner Zeit nachhaltig beeinflusste. Seine Werke bieten nicht nur einen tiefen Einblick in die Geschichte des Exils, sondern auch in die geistigen und politischen Kämpfe des 20. Jahrhunderts. Quellen: „Politik und Literatur im Exil: Deutschsprachige Schriftsteller im Kampf gegen den Nationalsozialismus“ – Untersuchung der Rolle von Intellektuellen im Exil. „Alfred Kantorowicz und der Spanische Bürgerkrieg“ – Analyse von Kantorowicz’ politischem Engagement während des Spanischen Bürgerkriegs. „A Wanderer Between the Worlds: Alfred Kantorowicz in East and West“ – Biografische Studie zu Kantorowicz’ Leben und politischen Ansichten. „Die Exilliteratur im 20. Jahrhundert“ – Darstellung der literarischen und politischen Aspekte des Exils. „Der kommunistische Intellektuelle: Alfred Kantorowicz und der politische Widerstand“ – Fokus auf seine politische Rolle im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Erich Weinert (1890–1953) war ein deutscher Dichter, Kabarettist, Schriftsteller und Kommunist, der eine zentrale Rolle in der antifaschistischen Literatur und der Arbeiterbewegung spielte. Sein Leben war von politischem Engagement, Widerstand gegen den Nationalsozialismus und einem tiefen Glauben an die sozialistische Bewegung geprägt. Weinert wuchs in einer sozialdemokratisch orientierten Familie in Magdeburg auf. Nach seiner Schulzeit und einer Lehre als Mechaniker entschloss er sich, Kunst zu studieren, und besuchte von 1908 bis 1910 die Kunstgewerbeschule in Magdeburg und die Königliche Kunstschule in Berlin. Anschließend arbeitete er als Kunstlehrer und Illustrator. Seine ersten literarischen Arbeiten veröffentlichte er 1921, und bereits in seinem ersten Gedichtband Affentheater (1925) äußerte er seine gesellschaftskritischen Ansichten und seinen satirischen Humor, der später zu einem Markenzeichen seiner Werke wurde. Politisch engagierte sich Weinert bereits zu Beginn der 1920er Jahre, als er der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) beitrat und sich mit gleichgesinnten Künstlern in revolutionären und sozialistischen Kreisen bewegte. Er trat aktiv in politischen Kabaretts wie „Retorte“ in Leipzig und „Kü-Ka“ in Berlin auf und arbeitete mit linken Zeitungen zusammen. Seine scharfsinnigen, oft humorvollen Gedichte und Essays waren ein wesentliches Element der Arbeiterbewegung und spiegelten seine politische Überzeugung wider. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 emigrierte Weinert zunächst in die Schweiz und später nach Frankreich und schließlich in die Sowjetunion. Während des Spanischen Bürgerkriegs (1936–1939) trat er den Internationalen Brigaden bei und kämpfte gegen die faschistische Diktatur von Francisco Franco. In dieser Zeit verfasste er Berichte und Gedichte über seine Erfahrungen, die später in seinem Buch Camaradas (1952) veröffentlicht wurden. Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941 intensivierte Weinert sein Engagement gegen den Nationalsozialismus. Er war in der antifaschistischen Propaganda aktiv, schrieb Flugblätter und Gedichte, die deutsche Soldaten zum Überlaufen bewegen sollten. Während des Krieges wurde er Präsident des Nationalkomitees „Freies Deutschland“, einer Organisation von Kriegsgefangenen und Emigranten, die sich gegen den Nationalsozialismus stellten. In seinen Kriegserinnerungen, insbesondere dem Werk Memento Stalingrad (1951), verarbeitete er die Schrecken des Krieges und die Notwendigkeit des Widerstands gegen die Nazi-Herrschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte Weinert 1946 nach Deutschland zurück und engagierte sich aktiv in der Kulturpolitik der DDR. Er wurde Mitglied der Deutschen Akademie der Künste und setzte sich für die Förderung der Arbeiterdichtung und sozialistischer Literatur ein. 1949 wurde er mit dem Nationalpreis der DDR ausgezeichnet. Erich Weinert starb 1953 in Ost-Berlin. Trotz seiner politischen Orientierung und seines Engagements für die sozialistische Bewegung blieb er ein bedeutender literarischer Geist des 20. Jahrhunderts, dessen Werke die politische und gesellschaftliche Realität seiner Zeit reflektierten. Posthum wurden viele seiner Arbeiten veröffentlicht, darunter eine Sammlung seiner Gedichte und Werke, die das breite Spektrum seiner literarischen und politischen Tätigkeiten dokumentieren. Quellen: Erich Weinert – Leben und Werk von Werner Preuß Erich Weinert. Schriftsteller und Kommunist von Gerd Dietrich Artikel über Erich Weinert in der Deutschen Biographie Werke von Erich Weinert, insbesondere Camaradas und Memento Stalingrad Zeitgenössische Berichterstattung über den Spanischen Bürgerkrieg und Weinerts Rolle in den Internationalen Brigaden Minna Specht (1879–1961) war eine deutsche Pädagogin und Widerstandskämpferin, die sich für sozialistische Bildungsreformen und gegen den Nationalsozialismus einsetzte. Sie spielte eine Schlüsselrolle in der sozialistischen Reformpädagogik und engagierte sich in verschiedenen politischen Bewegungen, die auf die Schaffung einer demokratischeren und gerechteren Gesellschaft abzielten. Specht wurde am 22. Dezember 1879 in Reinbek bei Hamburg geboren und wuchs in einer bürgerlichen Familie auf. Nach dem Besuch der Schule und einer Lehrerinnenausbildung studierte sie Geographie, Geschichte, Philosophie und Geologie an verschiedenen Universitäten. Sie war zunächst als Lehrerin tätig und engagierte sich früh in der reformpädagogischen Bewegung, die eine moderne, auf die Bedürfnisse der Kinder ausgerichtete Bildung forderte. Ihr Interesse an politischer Bildung führte sie zu einer engen Zusammenarbeit mit Leonard Nelson, einem Philosophen und Sozialisten, mit dem sie eine Lebensgemeinschaft einging und den Internationalen Jugendbund (IJB) gründete. Dieser setzte sich für eine sozialistische Erziehung und die politische Bildung der Jugend ein. In den 1920er Jahren leitete Specht das Landerziehungsheim Walkemühle, das als Modellschule für die Ideen des IJB diente. Die Schule förderte nicht nur die intellektuelle Entwicklung der Schüler, sondern auch eine aktive politische und soziale Bewusstseinsbildung. Nach dem Tod von Leonard Nelson 1927 führte Specht die Organisation weiter und setzte sich zunehmend für die Schaffung einer antifaschistischen Einheitsfront ein. 1932 unterzeichnete sie den „Dringenden Appell“ des IJB, der zum Widerstand gegen den aufkommenden Nationalsozialismus aufrief. Nach der Machtergreifung der Nazis 1933 wurde die Walkemühle von der SA besetzt und enteignet, was Spechts Emigration notwendig machte. Sie flüchtete zunächst nach Dänemark, wo sie eine Schule für deutsche Emigrantenkinder gründete. Später zog sie nach Großbritannien und wurde dort 1939 für ein Jahr interniert. Nach ihrer Freilassung engagierte sie sich weiterhin in der politischen Bildung und setzte sich für eine Reeducation nach dem Krieg ein. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte Specht 1946 nach Deutschland zurück und übernahm die Leitung der Odenwaldschule, wo sie ihre reformpädagogischen Ideen weiterverfolgte. Unter ihrer Leitung wurde die Schule zu einem Zentrum für eine demokratische, sozialistische Bildung. Sie setzte sich besonders für die Integration von Flüchtlingskindern ein und förderte eine Schule, die Werte wie Gerechtigkeit, Demokratie und soziale Verantwortung lehrte. 1951 trat sie von der Leitung der Schule zurück, blieb aber weiterhin in der Bildungsarbeit aktiv und war auch Mitglied der Deutschen UNESCO-Kommission. Specht starb am 3. Februar 1961 in Bremen. Ihr Engagement für die reformpädagogische Bewegung und ihre Rolle im Widerstand gegen den Nationalsozialismus bleiben unvergessen. In verschiedenen Städten tragen Schulen ihren Namen, und ihre pädagogischen Ideen haben die Entwicklung der deutschen Bildungslandschaft nachhaltig beeinflusst. Quellen: Biografie von Minna Specht in der Enzyklopädie der Deutschen Widerstandskämpfer Minna Specht und die reformpädagogische Bewegung von Michael Jäckel Artikel über Minna Specht in der Biographischen Enzyklopädie Artikel zu Minna Specht auf der Website des Archiv der sozialen Demokratie Erziehung im Widerstand: Minna Specht und die Odenwaldschule von Heike Raab Willi Bredel (1901–1964) war ein deutscher Schriftsteller, Kommunist und Widerstandskämpfer, der durch sein literarisches Werk und seine politische Arbeit einen bedeutenden Einfluss auf die sozialistische Kultur- und Literaturpolitik in der DDR hatte. Bredels Leben und Schreiben waren von seiner engagierten Haltung gegen den Nationalsozialismus sowie seiner tiefen Verbundenheit mit der Arbeiterbewegung geprägt. Geboren am 2. Mai 1901 in Hamburg, wuchs Bredel in einem sozialistischen Umfeld auf und trat bereits in jungen Jahren der sozialistischen Bewegung bei. Nach einer Ausbildung als Drehergeselle und einem kurzen Aufenthalt als Arbeiter im Hamburger Hafen arbeitete er als Journalist und Redakteur. 1919 trat er der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) bei und engagierte sich politisch. 1923 war er aktiv am Hamburger Aufstand beteiligt und wurde dafür verhaftet und zu zwei Jahren Haft verurteilt. Nach seiner Entlassung setzte er seine politische Arbeit fort, war aber weiterhin auch als Schriftsteller tätig und veröffentlichte zunächst kleinere Erzählungen und Artikel. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde Bredel von der Gestapo verhaftet und im Konzentrationslager Fuhlsbüttel inhaftiert. Seine Erfahrungen im KZ verarbeitete er in seinem ersten bedeutenden Werk, dem 1934 veröffentlichten Roman Die Prüfung, in dem er die unmenschlichen Zustände im Konzentrationslager und die Auswirkungen des nationalsozialistischen Terrors thematisierte. Der Roman wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und gilt als eines der ersten literarischen Werke, das authentisch von den Erlebnissen im nationalsozialistischen System berichtete. Nach seiner Haftentlassung emigrierte Bredel nach Tschechoslowakei, dann nach Moskau und schließlich nach London. Dort engagierte er sich im Exil weiter im antifaschistischen Widerstand und trat 1937 als politischer Kommissar den Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg bei. Er kämpfte dort gegen die faschistische Franco-Diktatur und erlebte die Brutalität des Krieges hautnah. Nach dem Ende des Spanischen Bürgerkriegs und der Niederlage der Republikaner setzte er seine antifaschistische Arbeit fort und schloss sich der Roten Armee an, wo er in der Kriegspropaganda tätig war. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte Bredel 1945 in die sowjetische Besatzungszone zurück und setzte sich für den Wiederaufbau des sozialistischen Deutschlands ein. In der DDR arbeitete er aktiv an der Entwicklung einer sozialistischen Literatur und war Mitglied der SED. Er war von 1947 bis 1950 Redakteur der Zeitschrift Heute und Morgen und später der Neuen Deutschen Literatur. 1950 wurde er Mitglied der Deutschen Akademie der Künste und setzte sich für die Entwicklung einer sozialistischen Literatur ein, die sich mit den Fragen der Arbeiterbewegung, des Widerstands gegen den Faschismus und der sozialistischen Utopie auseinandersetzte. Bredels bedeutendstes literarisches Werk ist die Trilogie Verwandte und Bekannte, die die Geschichte einer sozialdemokratischen Arbeiterfamilie in Hamburg über mehrere Generationen hinweg erzählt. Weitere Werke, wie Die Vitalienbrüder und Begegnung am Ebro, befassen sich mit den Themen Widerstand und Solidarität in der Arbeiterbewegung und im Krieg. Sein Engagement für eine sozialistische Literaturpolitik und seine persönliche politische Haltung machten ihn zu einer zentralen Figur der DDR-Literatur. Willi Bredel starb am 23. Februar 1964 in Berlin. Sein literarisches Werk und seine politische Arbeit haben sowohl die Literatur der DDR als auch die antifaschistische Bewegung nachhaltig beeinflusst. Trotz seiner engen Verbindung zur SED bleibt sein Werk ein bedeutendes Zeugnis der sozialistischen Literaturgeschichte. Quellen: Biografie von Willi Bredel in der Deutschen Biographie Artikel über Willi Bredel in der Enzyklopädie des Widerstands 1933–1945 Willi Bredel und die sozialistische Literatur von Frank Jürgens Literaturkritik zu Willi Bredels Trilogie Verwandte und Bekannte in der DDR-Literatur Artikel zu Willi Bredel in der Wikipedia und weiteren wissenschaftlichen Quellen Hans Lorbeer (1901–1973) war ein deutscher Schriftsteller und politischer Aktivist, dessen Werk und Leben eng mit der sozialistischen Bewegung und dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus verbunden sind. Er setzte sich in seinen literarischen Arbeiten und seinem politischen Engagement für die Rechte der Arbeiterklasse ein und spielte eine wichtige Rolle in der Kulturpolitik der DDR nach dem Zweiten Weltkrieg. Lorbeer wurde am 15. August 1901 in Kleinwittenberg geboren. Als uneheliches Kind wuchs er bei Pflegeeltern in Piesteritz auf. Nach der Volksschule begann er eine Lehre als Installateur, doch schon früh zeigte er Interesse an Literatur und Politik. 1921 trat er der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) bei und engagierte sich in der sozialistischen Arbeiterbewegung. 1928 war er Mitbegründer des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller (BPRS), der eine sozialistische Literatur förderte und sich gegen die bürgerliche Kultur wandte. Seine ersten literarischen Arbeiten begannen in den 1920er Jahren, als er Gedichte und Erzählungen veröffentlichte, die die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse und die sozialen Missstände thematisierten. 1925 erschien sein erstes Buch, Gedichte eines jungen Arbeiters, das sich mit den Erfahrungen des Arbeitens in der Industrie und der Ausbeutung der Arbeiter beschäftigte. 1930 veröffentlichte er seinen ersten Roman Ein Mensch wird geprügelt, der die brutalen Arbeitsbedingungen und die soziale Ungerechtigkeit der Zeit anprangerte. Dieses Werk machte ihn in linken Kreisen bekannt. In den 1930er Jahren entfernte sich Lorbeer von der KPD und schloss sich der Kommunistischen Partei Deutschlands – Opposition (KPO) an. Wegen seiner politischen Haltung wurde er 1931 aus der KPD ausgeschlossen, doch er blieb weiterhin in der sozialistischen Bewegung aktiv. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde Lorbeer verhaftet und in das Konzentrationslager Lichtenburg sowie später in das Zuchthaus und das Moorlager inhaftiert. Während seiner Haft und der Zwangsarbeit unter der Aufsicht der Gestapo verarbeitete er seine Erlebnisse in späteren Werken. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte Lorbeer 1945 in die sowjetische Besatzungszone zurück und setzte sich in der Region für den Wiederaufbau der sozialistischen Ordnung ein. Er wurde Bürgermeister von Piesteritz und widmete sich später vollständig seiner Schriftstellerei. Lorbeer wurde für seine literarischen Leistungen mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Heinrich-Mann-Preis und dem Nationalpreis der DDR. Sein literarisches Werk umfasst Romane, Erzählungen, Gedichte und Dramen. Zu seinen bekanntesten Werken zählen die Trilogie Die Rebellen von Wittenberg (1956–1963), die die Geschichte von Aufständen in der Reformationszeit erzählt, sowie der Roman Der Spinner, der 1959 neu aufgelegt wurde. Auch in seinem Werk Ein Mensch wird geprügelt setzte sich Lorbeer mit den drückenden Arbeitsbedingungen und den Kämpfen der Arbeiterklasse auseinander. Lorbeer war ein bedeutender Vertreter der sozialistischen Literatur der DDR und trug mit seinen Werken zur politischen und kulturellen Prägung der Nachkriegszeit bei. Er setzte sich in seinen Texten stets für eine gerechtere Gesellschaft und die Befreiung der Arbeiterklasse ein. Hans Lorbeer starb am 7. September 1973 in Wittenberg, doch sein literarisches Erbe lebt weiter und ist in der DDR-Literatur und darüber hinaus anerkannt. Quellen: Alice Rühle-Gerstel (1894–1943) war eine deutschsprachige Schriftstellerin, politische Aktivistin und Frauenrechtlerin, die sich zeitlebens für eine sozialistische und gerechte Gesellschaft einsetzte. Ihre Werke sind stark von feministischen und sozialistischen Idealen geprägt, wobei sie die Rechte der Frauen und die Auseinandersetzung mit autoritären Strukturen in den Mittelpunkt stellte. Geboren am 24. März 1894 in Prag in eine jüdisch-deutsche Familie, besuchte sie das deutsche Mädchenlyzeum in Prag und ein Mädchenpensionat in Dresden. Nach dem Abschluss der Schule legte sie 1914 die Staatsprüfung für Musik ab und entschloss sich, Literatur und Philosophie zu studieren. Von 1917 bis 1921 studierte sie in Prag und München und promovierte 1921 mit einer Dissertation über Friedrich Schlegel und Chamfort. 1921 heiratete sie den Rätekommunisten Otto Rühle und wurde in der sozialistischen Bewegung aktiv. Sie gründete 1924 den Verlag Am andern Ufer und gab die Monatsblätter für sozialistische Erziehung heraus. Ihr literarisches Werk behandelte sowohl politische als auch gesellschaftliche Themen und reflektierte ihre kritische Haltung gegenüber autoritären Tendenzen in der sozialistischen Bewegung. Ihr bekanntestes Werk ist der Roman Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit (1930), in dem sie die inneren Konflikte einer Frau darstellt, die zwischen persönlicher Freiheit und gesellschaftlichen Erwartungen hin- und hergerissen ist. Der Roman ist eine frühe antistalinistische Auseinandersetzung und fordert die individuelle Freiheit innerhalb eines sozialistischen Rahmens. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 und aufgrund ihrer politischen Haltung verließ Alice Rühle-Gerstel Deutschland. Sie zog zunächst nach Prag und arbeitete dort für das Prager Tagblatt, bevor sie 1936 nach Mexiko emigrierte. In Mexiko-Stadt setzte sie ihre feministische und sozialistische Arbeit fort und schrieb für verschiedene Publikationen. Sie engagierte sich weiterhin für die Rechte von Frauen und arbeitete in der Kultur- und Arbeiterbewegung. Obwohl sie sich stark für die politischen Ideale einsetzte, litt sie unter den psychischen Belastungen des Exils. Am 24. Juni 1943 nahm sie sich das Leben. Ihr Werk bleibt ein wichtiger Beitrag zu den Diskussionen über soziale Gerechtigkeit, Feminismus und Widerstand gegen autoritäre Regime. Alice Rühle-Gerstel gilt als eine der wichtigen Schriftstellerinnen und Aktivistinnen des 20. Jahrhunderts, deren Arbeiten bis heute einen bedeutenden Einfluss auf sozialistische und feministischen Diskurse ausüben. Quellen: Biografie von Alice Rühle-Gerstel in der Deutschen Biographie Artikel zu Alice Rühle-Gerstel in der Enzyklopädie des Widerstands 1933–1945 Literatur und Widerstand: Schriftstellerinnen im Exil Alice Rühle-Gerstel: Eine Biografie von Petra Huber Erich Kästner (1899–1974) war ein deutscher Schriftsteller, Journalist und Drehbuchautor, der besonders für seine Kinderbücher und seine gesellschaftskritischen Werke bekannt wurde. Geboren am 23. Februar 1899 in Dresden, wuchs Kästner in einer einfachen Arbeiterfamilie auf. Nach dem Abitur und dem Ersten Weltkrieg, in dem er als Soldat diente, studierte er in Leipzig Germanistik, Geschichte und Theatergeschichte. Früh begann er mit dem Schreiben und veröffentlichte seine ersten Gedichte und Beiträge in Zeitungen. 1928 gab Kästner sein literarisches Debüt mit dem Gedichtband „Herz auf Taille“, doch es waren seine Kinderbücher, die ihn international bekannt machten. Werke wie Emil und die Detektive (1929), Pünktchen und Anton (1931) und Das fliegende Klassenzimmer (1933) machten ihn zu einem der bedeutendsten deutschen Kinderbuchautoren des 20. Jahrhunderts. In seinen Büchern stellte er Kinder in den Mittelpunkt, die auf realistische Weise mit den Herausforderungen des Lebens konfrontiert werden, was ihn von vielen seiner Zeitgenossen abhob. Auch in seinen anderen literarischen Arbeiten, wie etwa Ein Mann gibt Auskunft (1930) und Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke (1936), behandelte er gesellschaftliche Themen mit Witz und kritischem Blick. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 verschlechterte sich Kästners Situation. Obwohl seine Werke weitgehend verboten und öffentlich verbrannt wurden, blieb er in Deutschland und setzte sich weiterhin kritisch mit den politischen Entwicklungen auseinander. Während der Zeit des Nationalsozialismus durfte er nicht mehr unter seinem eigenen Namen veröffentlichen und schrieb stattdessen unter Pseudonymen. Zudem arbeitete er als Drehbuchautor für Filme, wobei er auch hier eine kritische Haltung gegenüber den nationalsozialistischen Tendenzen beibehielt. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte Kästner seine Arbeit fort und schrieb unter anderem das Kinderbuch Das doppelte Lottchen (1949) sowie Die Konferenz der Tiere (1949), in denen er wieder seine humanistischen Ideale und die Werte der Freundschaft und Zusammenarbeit hervorhob. Er arbeitete auch als Feuilletonredakteur für die Neue Zeitung in München und setzte sich für ein literarisches Engagement in einer demokratischen Gesellschaft ein. Für seine literarischen Leistungen erhielt Kästner zahlreiche Auszeichnungen, darunter das Bundesverdienstkreuz. Er starb am 29. Juli 1974 in München. Kästners Werke sind nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der deutschen Literatur und insbesondere der Kinder- und Jugendliteratur. Seine Bücher wurden vielfach verfilmt und sind weiterhin in Schulen und Bibliotheken präsent, wo sie nicht nur für ihre moralischen und gesellschaftlichen Themen, sondern auch für ihren humorvollen und verständlichen Stil geschätzt werden. Quellen: Biografie von Erich Kästner in der Deutschen Biographie Erich Kästner: Eine Biografie von Janne Böhme Literatur über Erich Kästner im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek Erich Kästner und der Widerstand: Eine Untersuchung seiner Haltung zum Nationalsozialismus von Claudia Hein Alfred Kubin (1877–1959) war ein österreichischer Maler, Grafiker, Schriftsteller und Illustrator, der als eine prägende Figur der modernen Kunst des 20. Jahrhunderts gilt. Geboren am 10. April 1877 in Leitmeritz, Böhmen, wuchs Kubin in einer bürgerlichen Familie auf und erlebte in jungen Jahren den Tod seiner Mutter, was ihn tief beeinflusste. Nach dem Besuch eines Gymnasiums in Salzburg und einer Lehre bei einem Fotografen in Klagenfurt zog Kubin 1898 nach München, wo er an der privaten Malschule von Ludwig Schmid-Reutte Unterricht nahm. Ab 1899 immatrikulierte er sich an der Königlichen Akademie für Malerei, brach das Studium jedoch bald ab, um sich intensiver seiner eigenen künstlerischen Entwicklung zu widmen. Im Jahr 1906 ließ sich Kubin in Schloss Zwickledt bei Wernstein am Inn nieder, wo er bis zu seinem Lebensende lebte. 1909 heiratete er Hedwig Schmitz, die Schwester des Schriftstellers Oscar A. H. Schmitz, und konnte dank ihrer Unterstützung das Schloss erwerben. Nach ihrem Tod zog sich Kubin zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück und lebte in fast völliger Klausur. Kubin war ein bedeutender Teil der mitteleuropäischen Kunst- und Literaturszene und beeinflusste die Moderne entscheidend. Besonders hervorzuheben ist sein literarisches Werk, insbesondere der 1909 erschienene Roman Die andere Seite, den er sowohl schrieb als auch illustrierte. In diesem Werk, das als eines seiner bedeutendsten gilt, verschmelzen Kubins markante Illustrationen mit einer düsteren, surrealen Erzählung. Auch seine Lithographien sind für ihren einzigartigen visuellen Ausdruck bekannt und trugen maßgeblich zu seiner künstlerischen Reputation bei. Kubin arbeitete und verkehrte mit bedeutenden Künstlern und Intellektuellen seiner Zeit, darunter auch Vertreter des Wiener Expressionismus und der Wiener Secession. Er gilt als einer der herausragenden Vertreter der deutschen und österreichischen Kunstszene des frühen 20. Jahrhunderts. Seine Werke, die häufig düstere, fantasievolle und mystische Themen behandeln, sind auch heute noch in vielen Museen und Galerien präsent. Neben seinen künstlerischen Arbeiten sind auch seine Lithographien von großer Bedeutung. Diese Werke, die oft düstere, symbolistische Themen aufgreifen, beeinflussten viele Künstler und Sammler. Ein bedeutendes Beispiel ist die Lithographie Epidemie aus den Jahren 1900/01, die 2019 für einen Rekordpreis von mehr als 1 Millionen Euro versteigert wurde. Für sein Lebenswerk wurde Kubin mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Großen Österreichischen Staatspreis für Bildende Kunst (1951) und dem Preis der Stadt Wien für Bildende Kunst (1950). Zudem erhielt er 1957 das Österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst und wurde 1955 mit dem Großen Sudetendeutschen Kulturpreis geehrt. In Anerkennung seines künstlerischen Beitrags wurde ihm auch die Gustav-Klimt-Plakette als Ehrenmitglied der Wiener Secession verliehen. Alfred Kubin starb am 20. August 1959 in Zwickledt bei Wernstein am Inn. Sein Werk bleibt ein bedeutender Beitrag zur Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts und wird weiterhin sowohl in Museen als auch auf dem internationalen Kunstmarkt hochgeschätzt. Quellen: Biografie von Alfred Kubin in der Deutschen Biographie Alfred Kubin: Leben und Werk von Herbert W. Franke Alfred Kubin – Die andere Seite: Eine Neuinterpretation von Stefan Karpfinger Literatur über Alfred Kubin im Katalog der Österreichischen Nationalbibliothek
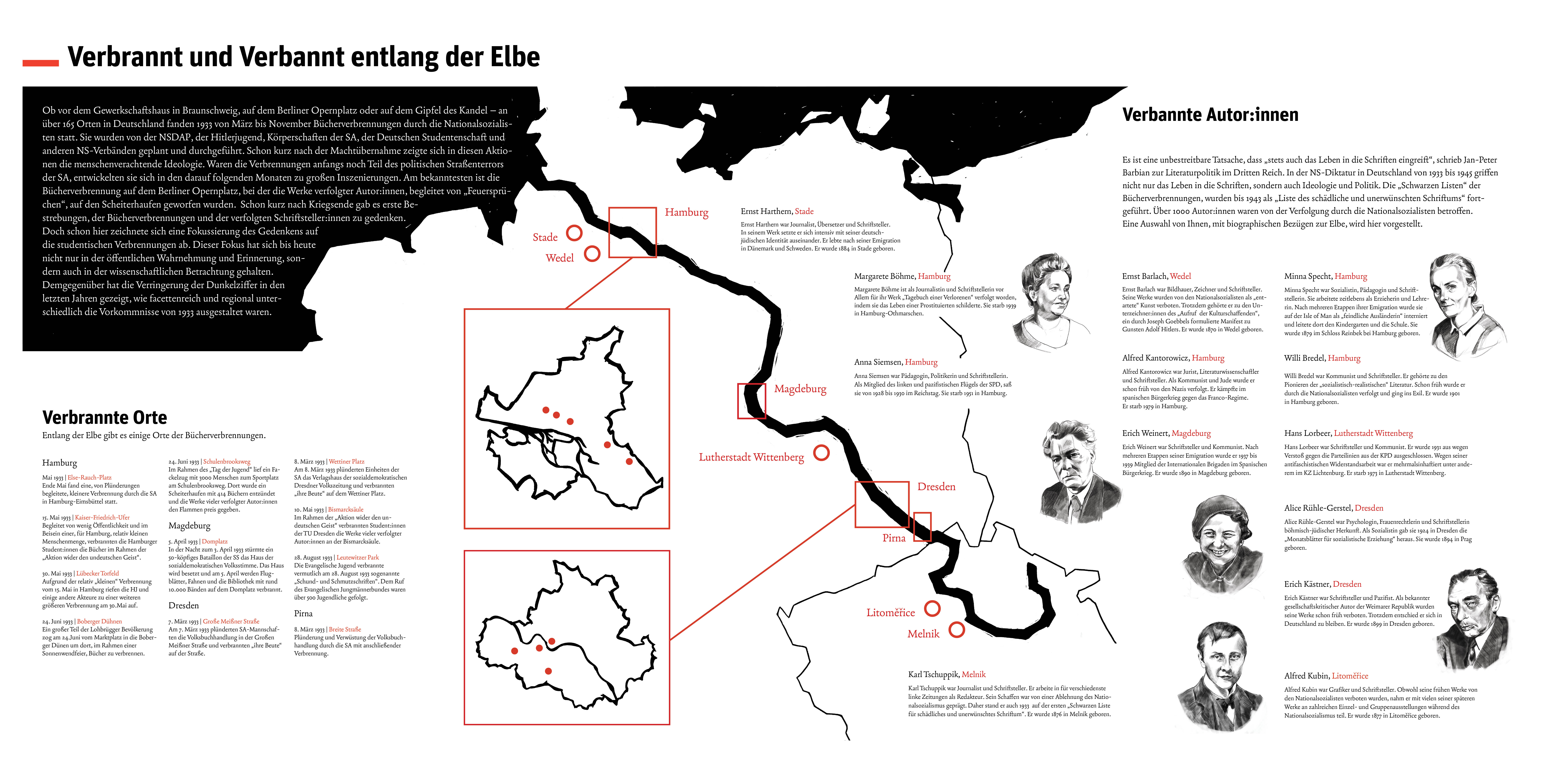
Mehr Infos zu Margarete Böhme

https://de.wikipedia.org/wiki/Margarete_B%C3%B6hme
(ISBN: 978-1879751326)Mehr Infos zu Ernst Harthem
Mehr Infos zu Anna Siemsen
Mehr Infos zu Karl Tschuppik
Mehr Infos zu Ernst Barlach
Mehr Infos zu Alfred Kantorowicz
Mehr Infos zu Erich Weinert
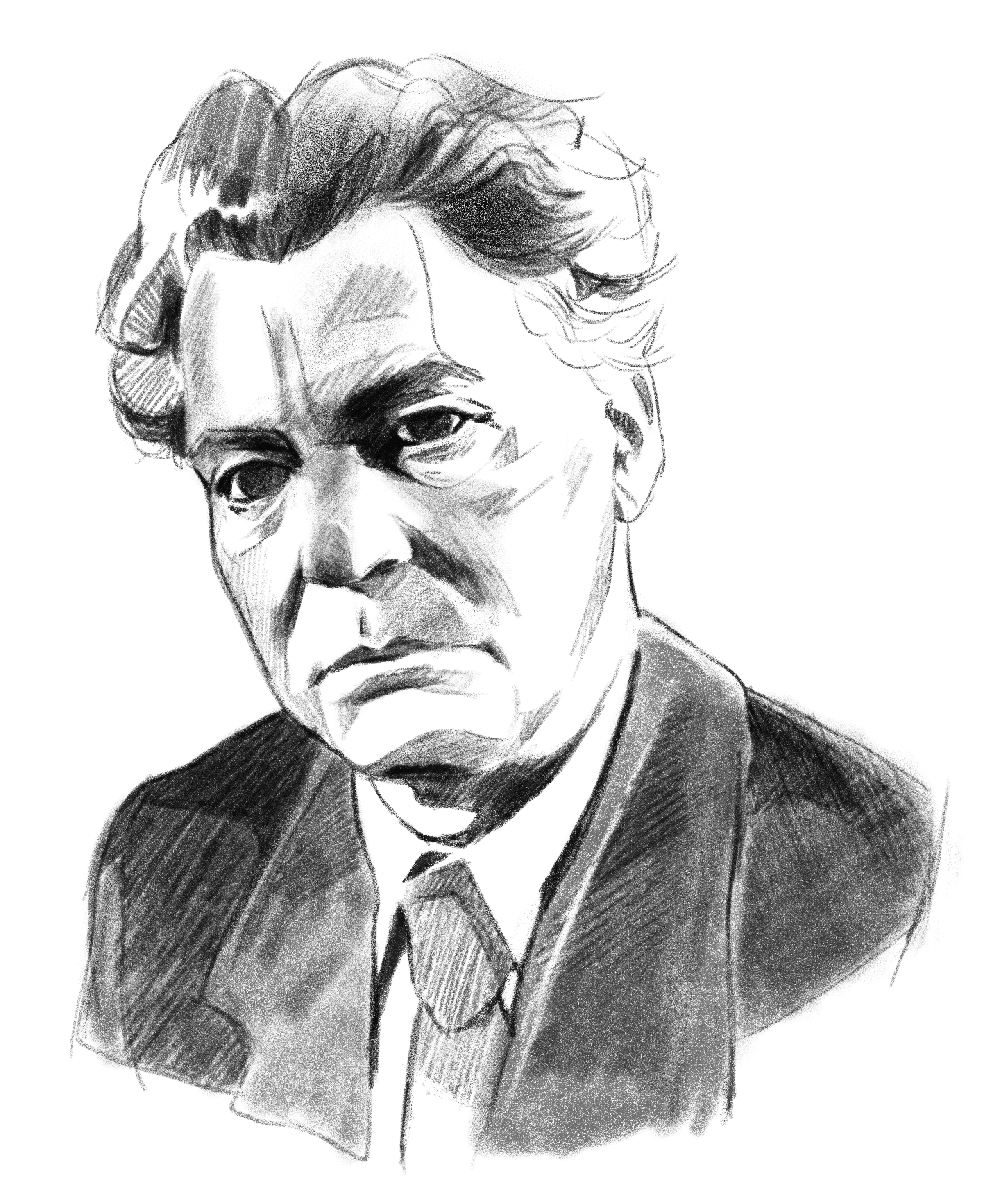
Mehr Infos zu Minna Specht
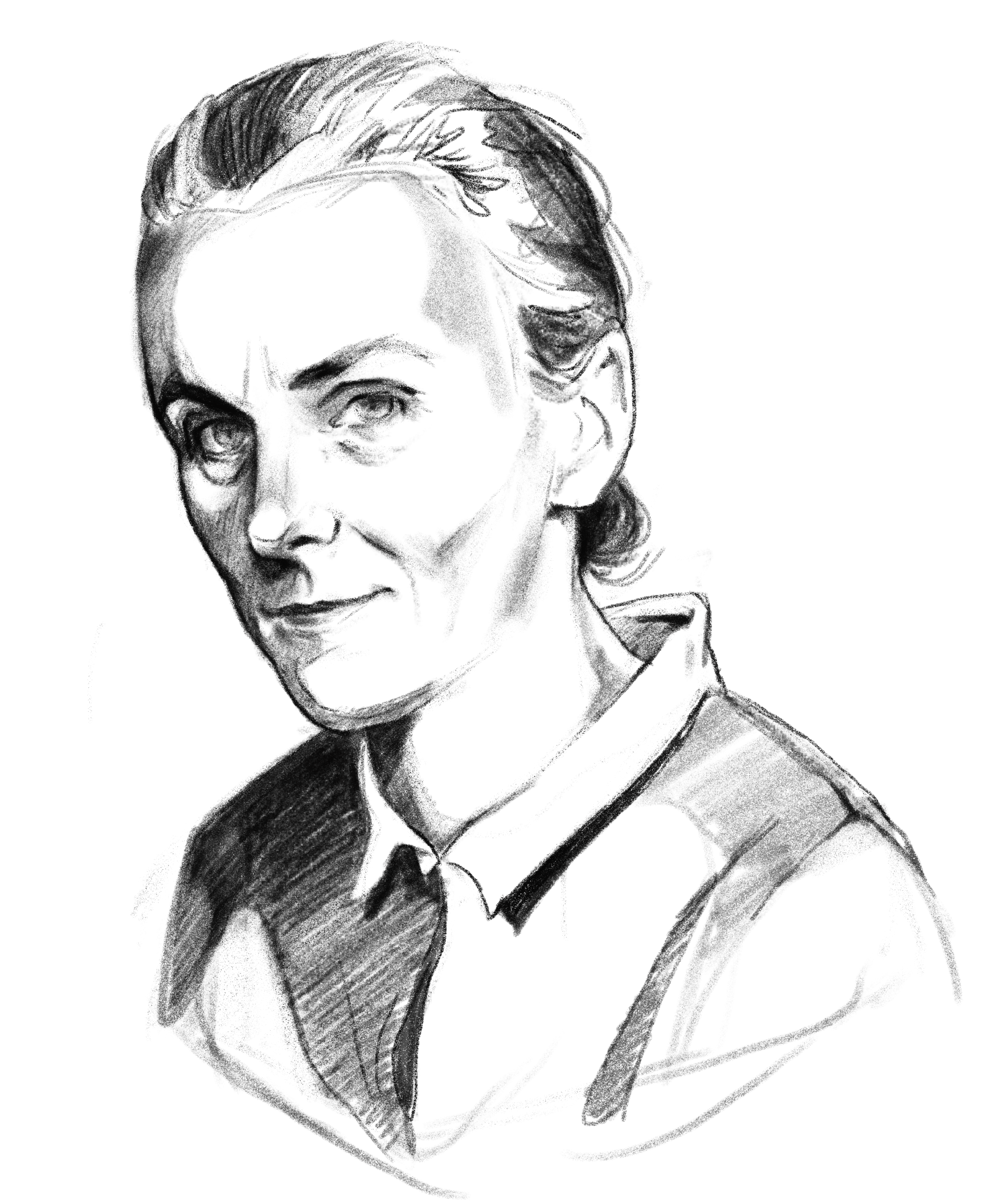
Mehr Infos zu Willi Bredel
Mehr Infos zu Hans Lorbeer
Mehr Infos zu Alice Rühle-Gerstel
Mehr Infos zu Erich Kästner
Mehr Infos zu Alfred Kubin